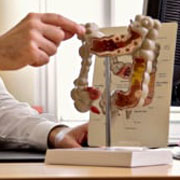Jährlich erkranken in Österreich 5000 Menschen an Karzinomen des Dickdarms. Es ist das dritthäufigste Karzinom bei Männern und das zweithäufigste bei Frauen. Das Kolonkarzinom ist mit einem mittleren Erkrankungsalter von knapp 70 Jahren überwiegend eine Erkrankung des höheren Lebensalters, insbesondere nach dem 50. Lebensjahr nimmt es deutlich zu. Kolonkarzinome entwickeln sich meist aus Polypen der Dickdarmschleimhaut. Etwa 64% der Karzinome finden sich im Sigma (Krummdarm) und im Rektum (Enddarm), 20% im linken Kolon, 6% im transversen Kolon und etwa 10% im rechseitigen Kolon.
Kompetente Hilfe bei Darm Beschwerden
Unklare Bauchbeschwerden, Änderungen der Stuhlgewohnheiten, Blut beim Stuhl, Gewichtsabnahme und Eisenmangel/Blutarmut sind Symptome die unbedingt bei einem Facharzt für Gastroenterologie weiter abgeklärt werden sollten.
Bitte nehmen Sie unabhängig von Beschwerden ab 45 Jahren die Vorsorgecoloskopie in Anspruch, diese wird in unserer Ordination angeboten.
Vereinbaren Sie möglichst bald einen Termin in meiner Ordination.
Bitte planen Sie zumindest 40 Minuten für die Erstordination ein und bringen Sie alle Vorbefunde mit. Es ist mir wichtig, die zielführende Diagnostik und Ihre optimale Behandlung mit Ihnen gemeinsam zu planen.
Symptome des Kolonkarzinoms
In der Regel verursachen Kolonkarzinome im Frühstadium selten Beschwerden und werden deshalb meistens zufällig entdeckt. Gelegentlich treten Bauchschmerzen, Darmbeschwerden, Änderung der Stuhlgewohnheiten oder ständige Abgeschlagenheit, Gewichtsabnahme und Blut im Stuhl auf.
Wird im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung mittels Stuhltest okkultes Blut im Stuhl gefunden, führt dies zur Durchführung einer Darmspiegelung, die die Diagnose des Dickdarmkrebses ergeben kann. Auch sichtbares Blut im Stuhl oder eine Schwarzverfärbung des Stuhls können Hinweis auf eine Darmkrebserkrankung sein.
Welche Untersuchungen sollten bei Verdacht auf Darmkrebs durchgeführt werden?
Falls der Verdacht auf ein Kolonkarzinom besteht, sind verschiedene Untersuchungen nötig, z. B. die körperliche Untersuchung, Laboruntersuchungen (Blut), die Ultraschalluntersuchung, die Darmspiegelung und die Computertomographie (CT).
Anamnese und körperliche Untersuchung
In einem ausführlichen Gespräch werden alle Beschwerden und Vorerkrankungen (auch familiäre Erbkrankheiten) erfragt und dokumentiert. Anschließend wird eine gründliche körperliche Untersuchung inklusive rektal digitaler Austastung vorgenommen.
Laboruntersuchungen
Die Blutuntersuchungen geben Aufschluss über den Allgemeinzustand und bestimmte Organfunktionen des Patienten. Veränderungen im Blut wie Blutarmut, Veränderung der Bluteiweiße, Erhöhung bestimmter Enzyme oder eine erhöhte Blutkörperchensenkung sind evtl. Hinweise auf eine Tumorerkrankung. Ein Tumormarker für das Kolonkarzinom ist das sogenannte CEA. Dieser Marker ist aber nur für die Verlaufskontrolle einer Darmkrebserkrankung wichtig, nicht für die Erstdiagnose.
Ultraschalluntersuchung (Sonographie)
Die Sonographie ist eine schmerzlose und strahlungsfreie Untersuchung zur Feststellung von möglichen Absiedelungen des Darmkrebses in der Leber oder in Lymphknoten im Bauchraum.
Darmspiegelung (Koloskopie)
Die Koloskopie ist die genaueste Untersuchung (Goldstandard), um ein Kolonkarzinom festzustellen.
Die Darmspiegelung wird durchgeführt, um der Ursache von Beschwerden im Bauchraum nachzugehen und/oder bei Blutarmut oder Blut im Stuhl eine mögliche Blutungsquelle im Darm zu finden. Bei dieser Untersuchung können auch Biopsien aus auffälligen Bereichen der Darmschleimhaut entnommen und der Dickdarmtumor so eindeutig festgestellt werden.
Dabei wird mit einem flexiblen, mit einer Videooptik versehenem Schlauch (Koloskop), der gesamte Dickdarm untersucht. Die Untersuchung findet in meiner Ordination als „sanfte Koloskopie“ in Sedierung statt, der Patient verschläft meist die Untersuchung, wodurch die Darmspiegelung in den allermeisten Fällen schmerzfrei für den Patienten verläuft. Anschließend sollten Sie sich noch 1 Stunde in unserem Ruheraum „ausschlafen“.
Computertomographie (CT)
Die Computertomographie ist eine schmerzlose, spezielle Röntgenuntersuchung (mit Kontrastmittelgabe), die den Körper Schicht für Schicht durchleuchtet. Dadurch kann in der Regel die Größe des Tumors und die genaue Tumorausbreitung und eventuell bestehende Metastasen, z.B. in der Leber, Lunge oder den Lymphknoten, festgestellt werden.
Welche Behandlungen des Kolonkarzinomes gibt es?
Die Therapiemethoden sind vom Tumorstadium abhängig. Je früher ein Dickdarmkrebs erkannt wird, umso günstiger ist die Prognose für den Patienten. Dabei spielt eine wesentliche Rolle, ob sich der Tumor in andere Organe ausgebreitet hat, also ob und in wie vielen Organen Metastasen vorliegen. Ferner ist wichtig, wie viele Metastasen im betroffenen Organ zu finden sind.
Lokale Tumorentfernung
Eine Heilung ist in der Regel für die früheren Tumorstadien durch chirurgische Therapie möglich. In der Regel wird eine Entfernung im Ganzen des tumortragenden Darmabschnitts und des regionalen Lymphabflussgebietes durchgeführt. Eine lokale chirurgische Tumorentfernung oder endoskopische Resektion ist nur im Frühstadium angezeigt. Die kurative Resektion einzelner Fernmetastasen bzw. auf einen Leberlappen beschränkter Lebermetastasen kann diskutiert werden und sollte wenn möglich durchgeführt werden, da so die Prognose deutlich gebessert werden kann.
Palliative Operation
Bei ca. 25% aller Dickdarmkrebspatienten liegt bereits zum Zeitpunkt der Diagnosestellung eine Lymphknoten- oder Fernmetastasierung vor. Bei stenosierenden Karzinomen ohne Möglichkeit der kompletten Resektion wird eine Umgehungsanastomose bzw. ein künstlicher Darmausgang durchgeführt, wenn eine komplette Resektion des Tumors nicht möglich ist.
Chemotherapie
Zytostatika sollen schnell wachsende Tumorzellen im Körper abtöten. Die stadienabhängige adjuvante (postoperative) und lindernde Chemotherapie ist anerkannter Bestandteil der Behandlung von Kolonkarzinomen. Durch die Einführung neuer Chemotherapeutika wurden in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte erzielt. Durch die Einführung von Antikörpern und sogenannten small molecules, die den Effekt von tumorspezifischen Wachstumsfaktoren (z.B. vom epidermalen Wachstumsfaktor (EGF)) oder angiogenetischen Zytokinen (vaskulärer Wachstumsfaktor (VEGF)) blockieren, können in Kombination mit Chemotherapie weitere Verbesserungen der Therapie erzielt werden.
Sekundäre Resektion nach Chemotherapie
Auch wenn die Größe oder Lage der Metastasen eine primäre Operation nicht zulässt, kann durch eine Chemotherapie in bestimmten Fällen eine Verkleinerung der Metastasen erreicht werden. Durch die hohen Ansprechraten der Kombinationschemotherapien (> 50%; s.u.) werden ca. 20% – 30% der Metastasen sekundär entfernbar (resektabel).
Palliativ-endoskopische Verfahren
Bei stenosierenden Kolonkarzinomen kann, wenn eine Operation nicht möglich ist, eventuell mittels endoskopischer Verfahren die Passage wiederhergestellt werden. In Frage kommen dazu Verfahren wie Erweiterung (Dilatation), Argon-Plasma-Koagulation, sowie die Implantation eines Metallgitterstents.
Palliative Strahlentherapie
Kolonkarzinome reagieren relativ strahlenunempfindlich. Aus diesem Grund wird die Strahlentherapie fast nur im fortgeschrittenen Stadium zur Schmerzlinderung insbesondere bei Knochenmetastasen eingesetzt.