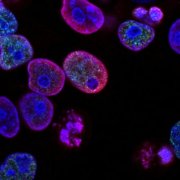Therapie des Reizdarm-Syndrom: Bis zu 70% Symptombesserung mit Diät-Umstellung – doch es geht noch besser!
Dr. Klaus Fleck, Medscape 9/2021
Die Therapie funktioneller Magen-Darm-Beschwerden stellt Ärzte und Patienten vor besondere Herausforderungen. Ein wesentlicher Baustein ist dabei die individualisierte Ernährungsberatung. Eine Möglichkeit dabei: die Reduktion schwer absorbierbarer Kohlenhydrate. Idealerweise ist die Ernährung aber Teil eines multidisziplinären Therapiekonzepts.
Letztendlich eine Ausschlussdiagnose
„Oft haben wir ein buntes Bild, wenn Patienten in der haus- oder fachärztlichen Praxis über Magen-Darm-Beschwerden klagen, etwa mit Dysphagie, Dyspepsie, Obstipation, Motilitätsstörungen oder einer Reizdarm-Symptomatik.“
Kriterien für das Reizdarm-Syndrom (RDS) sind wiederkehrende Bauchschmerzen (durchschnittlich an mindestens 1 Tag pro Woche in den letzten 3 Monaten), die mit der Stuhlentleerung bzw. Änderungen von Stuhlfrequenz oder Stuhlkonsistenz assoziiert sind.
In beiden Verdachtsfällen – Reizdarm oder funktionelle Gastropathie – ist es wichtig, auf Alarmsymptome zu achten.
Chronizität ist ebenso der wesentliche diagnostische Punkt bei der Einordnung einer funktionellen Dyspepsie in ein postprandiales Distress-Syndrom (u.a. mit Völlegefühl, Übelkeit und Brechreiz) oder epigastrische Schmerzen (u.a. mit Bauchkrämpfen).
In beiden Verdachtsfällen – Reizdarm oder funktionelle Gastropathie – ist es wichtig, auf Alarmsymptome wie Gewichtsverlust, in der Nacht auftretende Schmerzen oder andere somatische Befunde zu achten und diese gegebenenfalls abzuklären. Letztlich sind die Diagnosen Reizdarm oder funktionelle Gastropathie dann Ausschlussdiagnosen.“
Mit Low-FODMAP behandelt man das Reizdarm-Syndrom zwar nicht ursächlich, kann aber wirksam dessen Symptome reduzieren.
Verantwortlich gemacht für das Reizdarmsyndrom werden Störungen der intestinalen Barriere, der Motilität, der Sekretion oder der viszeralen Sensibilität bzw. ein Mischbild davon. Je nach der Zusammensetzung der Nahrung werden diese Funktionen dann unterschiedlich gestört.
Eliminations-Diät hilft, die Symptome zu reduzieren
Symptomatisch verbessern lassen sich Reizdarm-Beschwerden durch eine Veränderung der Ernährung. Hier spielt die Reduzierung kurzkettiger Kohlenhydrate wie Laktose, Fruktose oder Fruktane eine relevante Rolle; denn sie sind schwer absorbierbar, im Darmlumen osmotisch wirksam, und sie fördern die Gasbildung, weshalb sie bei Reizdarm-Patienten Symptome wie Diarrhö, Meteorismus und Schmerzen im Darmtrakt verursachen können.
Wir verstehen das Reizdarm-Syndrom damit mehr und mehr als ein Krankheitsbild, bei dem sowohl ernährungsbedingte (interne) als auch psychosoziale (externe) Stressoren eine Rolle spielen.
Therapeutisch günstige Effekte lassen sich hier durch die sogenannte Low-FODMAP-Diät erreichen (das Kürzel steht für fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole): Dabei eliminieren die Patienten an diesen Bestandteilen reiche Nahrungsmittel wie bestimmte Obst-, Gemüse- und Getreidesorten, laktosehaltige Milch und verarbeitete Fleisch-, Wurst- oder Fischwaren mehrere Wochen lang zunächst ganz, um sie danach vorsichtig testweise wieder einzuführen und dabei herauszufinden, was vertragen wird und was nicht.
Vorsicht vor Malnutrition
Mit Low-FODMAP behandelt man das Reizdarm-Syndrom zwar nicht ursächlich, kann aber wirksam dessen Symptome reduzieren. Wird die Diät eingehalten, sei Studien zufolge bei bis zu 70% der Patienten eine Verbesserung von abdominellen Schmerzen, Blähungen, Flatulenz und Diarrhö zu erwarten.
Sehr wichtig hierbei ist jedoch die speziell auf den einzelnen Patienten bezogene Ernährungsberatung, um das Ausmaß der FODMAP-Reduktion individuell auszutesten und das Ziel einer ausgewogenen Ernährung nicht aus dem Auge zu verlieren.
Den Vergleich zu Low-FODMAP braucht allerdings auch die klassische gastroenterologische Schonkost nicht zu scheuen: So zeigte eine schwedische Multicenter-Studie, dass die therapeutischen Effekte einer traditionellen Diät mit regelmäßigem Essen und der Reduktion u.a. von Fett, unlöslichen Ballaststoffen, Bohnen, Zwiebeln und Kaffee im Vergleich zu Low-FODMAP ähnlich positiv waren.
Ernährungsbedingte und psychosoziale Stressoren
Nicht selten beim Reizdarm-Syndrom sind psychosomatische Komorbiditäten: So zeigte eine auf Krankenkassen-Daten basierende Beobachtungsstudie zu Häufigkeit, Komorbiditäten, Versorgung und Kosten des Reizdarmsyndroms folgende Begleitdiagnosen:
Bei 42% der Reizdarm-Patienten wurden ebenfalls affektive Störungen diagnostiziert, bei 58% somatoforme Störungen, bei 20% andere Angststörungen
Multidisziplinäre Betreuung scheint überlegen
Um eine möglichst gute Symptom-Verbesserung bei Reizdarm-Patienten zu erzielen, scheint die multidisziplinäre Betreuung einer Standardbetreuung nur durch Gastroenterologen überlegen zu sein.
Die multidisziplinäre Variante umfasste dabei neben einer gastroenterologischen fachärztlichen Betreuung eine spezifische Ernährungsberatung sowie u.a. Hypnose, psychiatrische fachärztliche Betreuung und Physiotherapie mit Biofeedback.
Outcome nach 9 Monaten Beobachtungszeit: Die Symptomverbesserung lag in der multidisziplinären Variante um mehr als 50% höher als in der monodisziplinären Vergleichsgruppe. Ihre Vorteile zeigten sich darüber hinaus im Hinblick auf die psychosoziale Situation, die Lebensqualität und sogar die Behandlungskosten.
Zur Bestätigung der Diagnose Reizdarm- oder Reizmagensyndrom sollten jedenfalls die erforderlichen Untersuchungen (Koloskopie bzw. Gastroskopie, Ultraschall, Laboruntersuchungen) durchgeführt werden, um eine mögliche zugrundeliegende organische Ursache auszuschließen
Dr. Martin Scharf